Alle Vorgänge in Pflanzen sind eigentlich chemische Prozesse, genauer biochemische, da sie sich in Lebewesen abspielen. Viele Menschen halten Chemie für etwas Unbegreifliches. Die schlechten Erfahrungen haben oft schon in der Schule angefangen und wurden nie korrigiert. Aber wenn man sich gründlicher mit Pflanzen und ihren Bedürfnissen auseinandersetzen will, kommt man um ein paar chemische Einsichten nicht herum. Hier der Versuch, die grundlegenden Prinzipien zu erklären.
Ein Stoff ist überall und nirgends
Das größte Problem ist wohl zu akzeptieren, dass ein Stoff, ein chemisches Element, überall sein kann und doch immer etwas Anderes ist.
Wenn ein Element mit einem anderen eine Verbindung eingeht, kommt etwas Neues heraus, das mit den Ausgangsstoffen keine Gemeinsamkeit hat. Scheinbar ist das Element verschwunden, in Wirklichkeit ist es jedoch immer noch da, nur als Verbindung mit einem anderen Element (das auch verschwunden scheint).
Agrarchemie
Als Beispiel soll hier das Element Kohlenstoff dienen, gleichzeitig der Spitzenreiter in Bezug auf die Bildung von Verbindungen: Bekannt sind mehrere Millionen und täglich kommen neue dazu. Dagegen liegt die Anzahl der Verbindungen aller anderen Elemente bei um die 300 000.
Die drei wichtigsten Vorkommen von elementarem, also ungebundenem Kohlenstoff sind Diamant, Graphit (Bleistiftminen) und schwarze Kohle z. B. Holzkohle, Aktivkohle oder Ruß.
Wir Menschen, unser Körper besteht außer Wasser und Knochenkalk fast ausschließlich aus Kohlenstoffverbindungen. Dass wir dabei nicht schwarz aussehen, liegt an dem chemischen Grundgesetz, dass ein Stoff in einer Verbindung andere Eigenschaften hat, als allein oder in einer anderen Verbindung. Aber wenn Körper unter Luftabschluss erhitzt werden, zersetzen sich die Verbindungen und der Kohlenstoff kommt wieder zutage: Der Vorgang heißt folgerichtig „verkohlen“.
Aus der Aufzählung der Kohlenstoffverbindungen im vorigen Absatz kann man auch erkennen, dass Pflanzen besonders viel mit diesem Element zu tun haben. Das Kohlenstoffdioxid in der Luft ist ihre wichtigste "Nahrung" und zusammen mit Wasser und Lichtenergie verwandeln sie es in alle Materialien, aus denen sie bestehen (siehe den Artikel "Licht ist Pflanzennahrung"). Dünger als Pflanzennährstoffe zu bezeichnen ist also zumindest chemisch falsch. Pflanzen „ernähren“ sich von Kohlenstoffdioxid und Wasser und benötigen für deren Aufnahme, Photosynthese genannt, Sonnenlicht. Wenn Zimmerpflanzen zu dunkel stehen, verhungern sie. Stoffe im Boden spielen nur eine Rolle wie Mineralien in unserer Ernährung. Zur „Masse“ einer Pflanze tragen sie nichts bei.
Gleichzeitig hat die Chemie herausgefunden, dass Stoffe nicht „verschwinden“, wenn sie in einer Verbindung nicht mehr sichtbar sind. Sie sind noch da, auch wenn man sie nicht mehr erkennen kann. Wenn man die Verbindung zerstört, kommen sie wieder ans Licht, wie das Verkohlen von organischem Material deutlich zeigt. Da ist der Kohlenstoff wieder da, wahrscheinlich wird er durch Fäulnisbakterien weiter in Kohlenstoffdioxid verwandelt, das die nächste grüne Pflanze zum Aufbau von Zucker verwendet, der von einem Menschen gegessen und in seinen Körper eingebaut wird … ein ewiger Kreislauf.
So wie der Kohlenstoff verhalten sich im Prinzip alle Elemente: Sie gehen die unterschiedlichsten Verbindungen ein und sind dann scheinbar verschwunden. Kristalline Stoffe (Salze) enthalten Metalle, das flüssige Wasser ist aus den Gasen Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt, Nitrate enthalten Stickstoff, der in elementarer Form ein wichtiger Bestandteil der Atemluft ist.
Der norwegische Schriftsteller Jostein Gaarder hat die Natur an diesem Punkt mit einem Legokasten verglichen: Die ca. 100 Elemente entsprechen den verschiedenen Bausteinen, sie werden immer wieder in unterschiedlicher Anzahl zu etwas Neuem zusammengesetzt, wieder zerlegt und für etwas Anderes gebraucht. Die chemischen Elemente entsprechen in diesem Modell den Legosteinen, aus denen man ja auch die unterschiedlichsten Dinge bauen kann.
Es ist die Aufgabe der Bodenbakterien, die zu Verfügung stehenden Elemente und Verbindungen so ‚umzubauen‘, dass Pflanzen die benötigten Stoffe aufnehmen können.
⦁ Die Gase Kohlenstoffdioxid, Methan, Propan,
⦁ die Flüssigkeiten Alkohol, Benzin, Dieselöl,
⦁ die Feststoffe Zucker, Stärke, Zellulose,
⦁ Teer, Eiweiß, alle Öle und Fette, Enzyme, Farbstoffe
. . . alles das sind Kohlenstoffverbindungen.
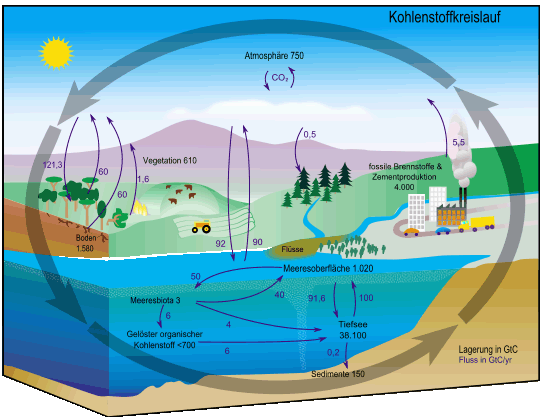
Diagramm des Kohlenstoffkreislaufes. Die schwarzen Zahlen zeigen wie viele Milliarden Tonnen Kohlenstoff (Gt C) in den verschiedenen Reservoiren vorhanden sind. Die blauen Zahlen zeigen an, wie viel Kohlenstoff zwischen den einzelnen Speichern pro Jahr ausgetauscht wird.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_cycle-cute_diagram-german.svg